Wie schwer manchen Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie das Lernen fiel, hatte Eylem Emir buchstäblich vor Augen. In den kleinen Kacheln auf ihrem Bildschirm konnte die Grundschul-Erzieherin sehen, wie Eltern in aller Ruhe vor dem Fernseher saßen, während ihr Kind versuchte, sich auf den Online-Unterricht zu konzentrieren. Eine Mutter kämmte der Tochter die Haare, damit sie ordentlich aussah, während die Kamera lief. Ein Junge versuchte verzweifelt, dem Online-Unterricht von der Küche aus zu folgen, weil die älteren Geschwister Wohn- und Kinderzimmer besetzt hatten – nur leider veranstaltete seine Mutter mit einer ihrer Töchter dort gleichzeitig einen Großputz mit viel Lärm.
„Da kommt so vieles zusammen“, sagt Eylem Emir. „Für diese Kinder war der Online-Unterricht ein großer Nachteil.“ Denn vieles, das für die einen Schülerinnen und Schüler selbstverständlich ist, haben die anderen schlicht nicht: ein eigenes Zimmer, einen eigenen Arbeitsplatz, einen ruhigen Arbeitsplatz, einen funktionierenden PC …
Stattdessen haben nicht wenige Familien mehr Angehörige als Zimmer, die Zimmer sind klein, und es gibt keinen Arbeitsplatz oder nur einen, den man sich mit dem Rest der Familie teilen muss. Oft ist da kein PC oder nur einer, der kein stabiles Internet hat, oder einer für alle Familienangehörigen, sodass die schulische Arbeit am Rechner auch noch in Konkurrenz zu Homeoffice und den diversen Gaming-Zeiten der restlichen Familienmitglieder tritt. Ein Drucker fehlt ebenfalls oft, oder der vorhandene funktioniert nicht, oder er hat keinen Toner oder kein Druckerpapier, und für beides ist gerade das Geld knapp, und so werden halt keine Arbeitsblätter ausgedruckt.

Bildungsferne Familien und Medienkompetenz – das passt selten zusammen
Kinder in Deutschland wachsen unter enorm unterschiedlichen Voraussetzungen auf. Die Pandemie hat darauf ein Schlaglicht geworfen und in den Schulen noch einmal deutlich gemacht, dass wir eben nicht davon ausgehen dürfen, alle Kinder mit der gleichen Pädagogik erreichen und fördern zu können. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, mit welchen Werten, Gewohnheiten und Fähigkeiten ein Kind ist die Schule kommt. Die Medienkompetenz ist dabei längst nicht das einzige, aber ein besonders offensichtliches Problem. Denn schon in normalen Zeiten fällt vielen Kindern der Umgang mit PC, Handy und Co. nicht leicht.
Tatsächlich sind in den meisten Familien ja genug Computer vorhanden: in Form von Smartphones, die oft jedes einzelne Familienmitglied besitzt. Mit zwölf Jahren haben 95 Prozent der Kinder ein eigenes Gerät – wunderbar, könnte man meinen, damit lässt sich doch arbeiten. Aber das wissen alle besser, die schon einmal versucht haben, auf dem Mini-Bildschirm schwierige Texte zu lesen oder trotz ständig eintreffender Nachrichten und Verlockungen wie Video-Gucken, Daddeln und Social-Media-Aktivitäten an herausfordernden Aufgaben dran zu bleiben, die als eher unangenehm empfunden werden.
Die meisten Schülerinnen und Schüler verwenden ihr Smartphone von sich aus nicht als Arbeitsgerät, sondern ganz im Gegenteil zur Ablenkung. In vielen Familien greifen dann die Eltern ein und steuern die Handynutzung ihrer Kinder. Das gelingt aber nicht allen Müttern und Vätern: In Umfragen äußern Eltern mit niedrigem eigenen Bildungsstand besonders häufig, dass es ihnen schwerfällt, den Handykonsum ihrer Kinder zu regulieren. Trotzdem erhalten Kinder aus solchen Familien tendenziell sogar früher ein eigenes Smartphone als andere. Lehrkräfte müssen daher damit rechnen, dass diese ohnehin benachteiligten Kinder besonders früh und besonders stark vom Handy beim Lernen gestört werden.
Vor dem Fernseher sind Kinder ruhig – und machen keine Unordnung
„Ganz unabhängig von Corona ist vielen Eltern nicht bewusst, dass es für ein Kind regelrecht schädlich sein kann, viele Stunden vor dem Handy, dem Fernseher oder der Spielekonsole zu verbringen“, weiß Eylem Emir. Sie sähen eher, dass Kinder in der Zeit vor einem dieser Geräte weniger Lärm machen und weniger miteinander streiten, was in kleinen, hellhörigen Wohnungen eine große Erleichterung sei. Zudem lassen sie ihre Eltern in Ruhe und machen in der Wohnung keine Unordnung. Letzteres ist beispielsweise in Familien wichtig, für die Gastfreundschaft ein besonders hoher Wert ist und die daher jederzeit in der Lage sein möchten, Gäste angemessen zu empfangen und zu bewirten. Hinzu kommt die Hoffnung vieler Migrantinnen und Geflüchteter, dass ihre Kinder durch deutsches Fernsehen die deutsche Sprache besser lernen.

Diese Mischung aus mangelndem Wissen, schwierigen Wohnumständen und kulturellen Unterschieden führt dazu, dass elektronische Medien in vielen Familien mit Migrationsgeschichte eine große und ungesunde Rolle spielen. Eylem Emir erzählt: „Ich habe zum Beispiel einen Zweitklässler erlebt, der immer wieder während der Hausaufgabenbetreuung die Hände hob, als halte er ein Gewehr, der Kampfgeräusche und Roboterbewegungen machte und ganz offensichtlich in die Welt seiner Computerspiele eintauchte. Immer wieder musste man ihn aus dieser Welt zurückholen. Ich hatte den Eindruck, dass es zu Hause für ihn keine Alters- und Zeitbegrenzung beim Gamen gab.“
Auch für einen anderen Jungen war es nach dem Lockdown und der Homeschooling-Zeit unglaublich schwer, sich wieder auf die Schule umzustellen. „Immer wieder hat er mich gefragt: Wie spät ist es? Wann kann ich nach Hause gehen?“, berichtet Emir. „Als ich nach dem Grund fragte, lautete die Antwort: Damit ich zocken kann.“ Dieser Junge fand den Lockdown cool, weil er so viel zocken konnte, wie er wollte. Und er sagte offen, wie gerne er nach Hause gehen würde, um weiterzuspielen.
Wie Medienkompetenz gefördert werden kann
Medienkompetenz betrifft die ganze Familie. Wer Kinder darin fördern möchte, muss deshalb auch bei den Eltern ansetzen. Wie das zum Beispiel gelingen kann, zeigt ein Programm, das Eylem Emir mit den Müttern in ihrer Stadtteilgruppe durchgeführt hat. Dort informierte sie die Frauen darüber, wie wichtig Feinmotorik und sprachliche Entwicklung für Kinder sind, wie beides gefördert werden kann und welche negativen Auswirkungen Dauer-Fernsehkonsum in dem Zusammenhang für ihre Kinder hat. In vielen Gruppengesprächen und in Rollenspielen wurden die Mütter motiviert, den Fernseher zu Hause einfach mal auszumachen.
Zu Hause stießen die Mütter mit ihrem Vorhaben erst einmal auf Widerstand. Die Kinder waren an den laufenden Fernseher gewöhnt, sie weinten und rebellierten. Aber einige Mütter hatten auch bald Erfolge. Emir: „Einmal rief mir eine Mutter, die ihre Kinder bislang eher verwöhnt hatte, vom Fahrrad aus zu: ‚Ich habe es geschafft! Ich habe den Fernseher ausgemacht. Es klappt. Wir schauen kein Fernsehen mehr‘. Eine Woche darauf hat sie in der Gruppe erzählt, wie viel Angst sie davor hatte, was ihr Sohn anstellen würde, wenn sie konsequent bleiben würde. Sie habe gedacht: Ich will diesen Stress nicht! Ich hab die Zeit dafür nicht! Ich kann das nicht ertragen! Trotzdem ist sie konsequent geblieben, sagte sie: ‚Weil ich wusste, wie wichtig es ist, war ich ganz stabil wie ein großer Baum. Ich habe den Fernseher ausgemacht, und es funktionierte.‘“
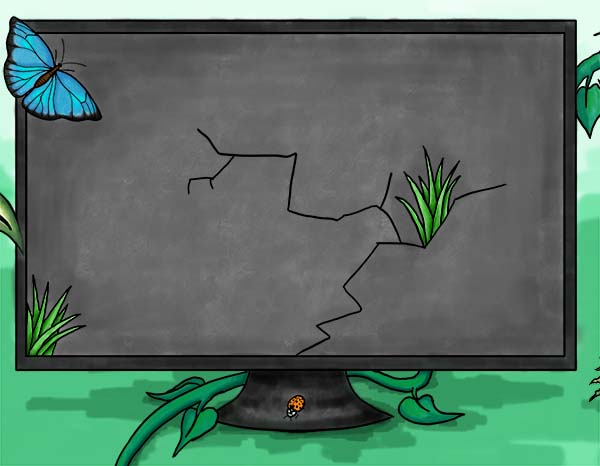
Lehrerin Heidemarie Brosche erzählt: „Ich besuchte im Rahmen eines Projektes gemeinsam mit einer Kollegin von der Jugendhilfe eine Familie, die aus einem arabischen Land geflüchtet war. Es gab Probleme mit ihrem Sohn in der Schule. Wir hatten in einen Abendtermin eingewilligt, damit auch der Vater anwesend sein konnte. Die Eltern empfingen uns höflich und baten uns ins blitzsaubere und aufgeräumte Wohnzimmer. Gerade als wir in das Gespräch einsteigen wollten, wurde der Fernseher eingeschaltet. Ich war so fassungslos, dass mir erst mal der Mund offenstand. Meine Kollegin hatte das wohl schon öfter erlebt. Sie bat freundlich darum, das Gerät wieder auszuschalten, was umgehend befolgt wurde. Später erklärte mir Eylem Emir, dass dies ein Akt der Gastfreundschaft der Eltern sein sollte. Ich verstand die Welt nicht mehr.“
Die Erklärung: Gastfreundschaft ist in vielen Familien mit Wurzeln in arabischen oder afrikanischen Ländern, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt ein hoher Wert. Der Gast gilt oft als Vertreter Gottes. Ihm bietet man nur das Beste. Und das Beste war in den vergangenen Jahrzehnten vielerorts eben der teure Fernseher. So zeigte man dem Gast die Wertschätzung: Du bist uns so viel wert, dass wir dir das Teuerste anbieten, was wir haben – selbst wenn der Strom teuer und das Geld knapp war. Wer das nicht gemacht hat, musste damit rechnen, dass seine Familie als unhöflich und geizig galt. Zwar ist ein laufender Fernseher heute nicht mehr das Teuerste, was man einem Gast bieten kann, aber viele, die mit dieser Tradition aufgewachsen sind, übernehmen sie bis heute. Außerdem dient der Fernseher der Kommunikation, er bietet Informationen über die Welt, Gesprächsthemen und somit Anlässe, sich miteinander auszutauschen. Und so sehen viele Menschen den laufenden Fernseher immer noch als Teil der Gastfreundschaft.
Eylem Emir: „Erst vor wenigen Wochen war ich bei einer arabischen Familie zu Gast. Als ich das Wohnzimmer betrat, wurde als Erstes das Fernsehgerät eingeschaltet. Ein Zeichentrickfilm in englischer Sprache lief, mit dem ich nun wirklich nichts anzufangen wusste. Es war aber ganz klar: Sie meinten es nicht böse. Sie zeigten mir so ihre Wertschätzung.“
Bald lief es bei den anderen Frauen ähnlich. Die Kinder spürten, dass es ihren Müttern wirklich ernst war und sie standhaft blieben, und so stellten sie ihren Widerstand ein. Vor allem aber boten die Mütter den Kindern nun Alternativen zum Fernsehen an, sie beschäftigten sich mit ihnen und unternahmen etwas gemeinsam. Und sie stellten dabei selbst fest: Das macht ja Spaß – und meinen Kindern tut es gut.
Allerdings sollte man nicht unterschätzen, wie viel Kraft Eltern dieser Schritt kosten kann – vor allem dann, wenn sie bislang Konflikten mit ihren Kindern in Sachen Mediennutzung aus dem Weg gegangen sind. Für die Mütter in Emirs Stadtteilgruppe waren die anderen Mütter enorm wichtig: Eine Gemeinschaft, in der sie sich austauschen, immer wieder stärken und motivieren konnten. Hier fanden auch die Rollenspiele statt, in denen die Mütter sich ein Gefühl dafür erarbeiteten, wie negativ der Einfluss des Fernsehens sein kann. Wenn die Mütter selbsttätig etwas lernten, hatte das mehr Erfolg, als wenn man ihnen nur Vorträge hielt.
Schulen müssen auch die Eltern in den Blick nehmen
Aus diesen Erfahrungen können auch Schulen lernen: Sie sollten ihre Türen öffnen und auch die Erwachsenen bilden. An den Schulen braucht es Menschen, die mit viel Beharrlichkeit erreichen, dass auch Eltern ohne eigenen, engen Bezug zur institutionellen Bildung eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufbauen können. Natürlich kostet das Zeit und Ressourcen, aber dafür gibt es ein passendes Gleichnis:
Ein Waldarbeiter bearbeitet mit einer Säge einen Baum im Wald. Er ist nicht sehr erfolgreich, denn die Säge ist völlig stumpf. Da kommt ein Wanderer vorbei und schlägt vor: „Wie wäre es, wenn du deine Säge einmal schleifst?“ Der Waldarbeiter aber antwortet: „Um Himmels willen! Dafür habe ich keine Zeit!“
Schulen müssen aufpassen, dass sie sich nicht wie der Waldarbeiter benehmen: Wenn der nicht wahrhaben will, dass er seine Säge schleifen muss, klappt das mit dem Sägen nicht, auch wenn er sich noch so viel Mühe gibt. Und wenn die Schulen nicht wahrhaben wollen, dass sie die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen müssen, klappt das mit den Kindern nicht, auch wenn sich die Lehrkräfte noch so viel Mühe geben.
Natürlich müssen Lehrkräfte neben ihrer normalen Tätigkeit nicht auch noch Eltern unterrichten. Aber es könnten Menschen – idealerweise mit Migrationshintergrund, aber das muss nicht sein – dafür bezahlt werden, dass sie mit den Eltern vertrauensvoll und kundig neben der Schule zusammenarbeiten. So könnten die Eltern die Schule mit ihren Ansprüchen zunehmend besser verstehen und zu Unterstützern ihrer Kinder werden. Die Säge wäre geschliffen!

Impulse von Lehrkraft zu Lehrkraft
Wenn wir Lehrkräfte uns bewusst machen, warum manche Kinder so viele Stunden vor dem Fernsehgerät, mit dem Handy oder der Konsole verbringen, können wir dies zumindest verstehen, auch wenn wir es nicht gutheißen.
Und wenn wir an unseren Schulen dafür plädieren, für Eltern ein handlungsorientiertes Medienkompetenz-Training („Medienführerschein“) anzubieten, können wir zumindest die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Schulen nicht wie der Waldarbeiter mit der stumpfen Säge benehmen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Wissensvermittlung über Selbsttätigkeit und Austausch zu den Übungen und Aktionen erfolgt.
Über die Autorinnen

Die Pädagogin und Autorin Heidemarie Brosche hat seit 1977 an Grund- und Hauptschulen unterrichtet sowie zahlreiche Sach- und Kinder- und Jugendbücher verfasst. Für ihr Engagement für Leseförderung und Bildungsgerechtigkeit wurde sie 2020 mit dem „Volkacher Taler“ der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geehrt. www.h-brosche.de
Dieser Artikel ist Teil der Serie „Bildungsfern? Bildungs-anders! Eine Übersicht aller weiteren Artikel finden Sie hier. Illustration: Ariane Dick Bellosillo/Magazin SCHULE

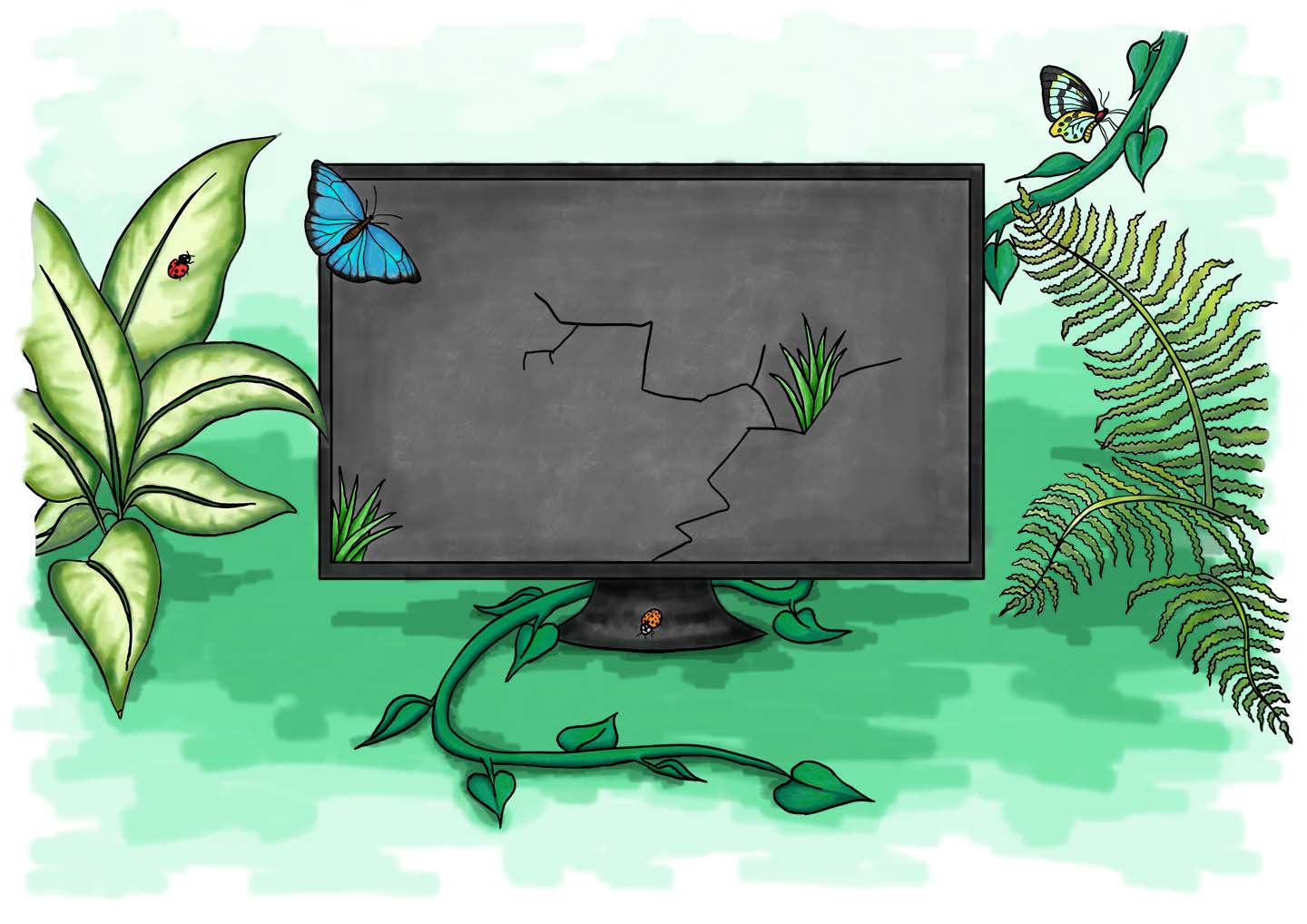













Sehr informative Artikelserie. Danke!
Klasse, der Begriff bildungs-anders. Was wir schon lange suchen, ist die Literatur, die auch deutsche Kinder aus bildungs-anderem Milieus beschreibt. Da haben Kids mit Migrationshintergrund und deutsche Arbeiterkinder einige Probleme gemeinsam. Beschrieben sind die Probleme von Mädchen, von Menschen mit Einschränkungen, mit Flucht- und Migrationshintergrund und intersektionale Diskriminierung. Aber warum gibt es keine Forschung zu den bildungs-anderen Kids hier in Haupt- und Förderschulen? Wir arbeiten dran: peer-leader-international e.V.