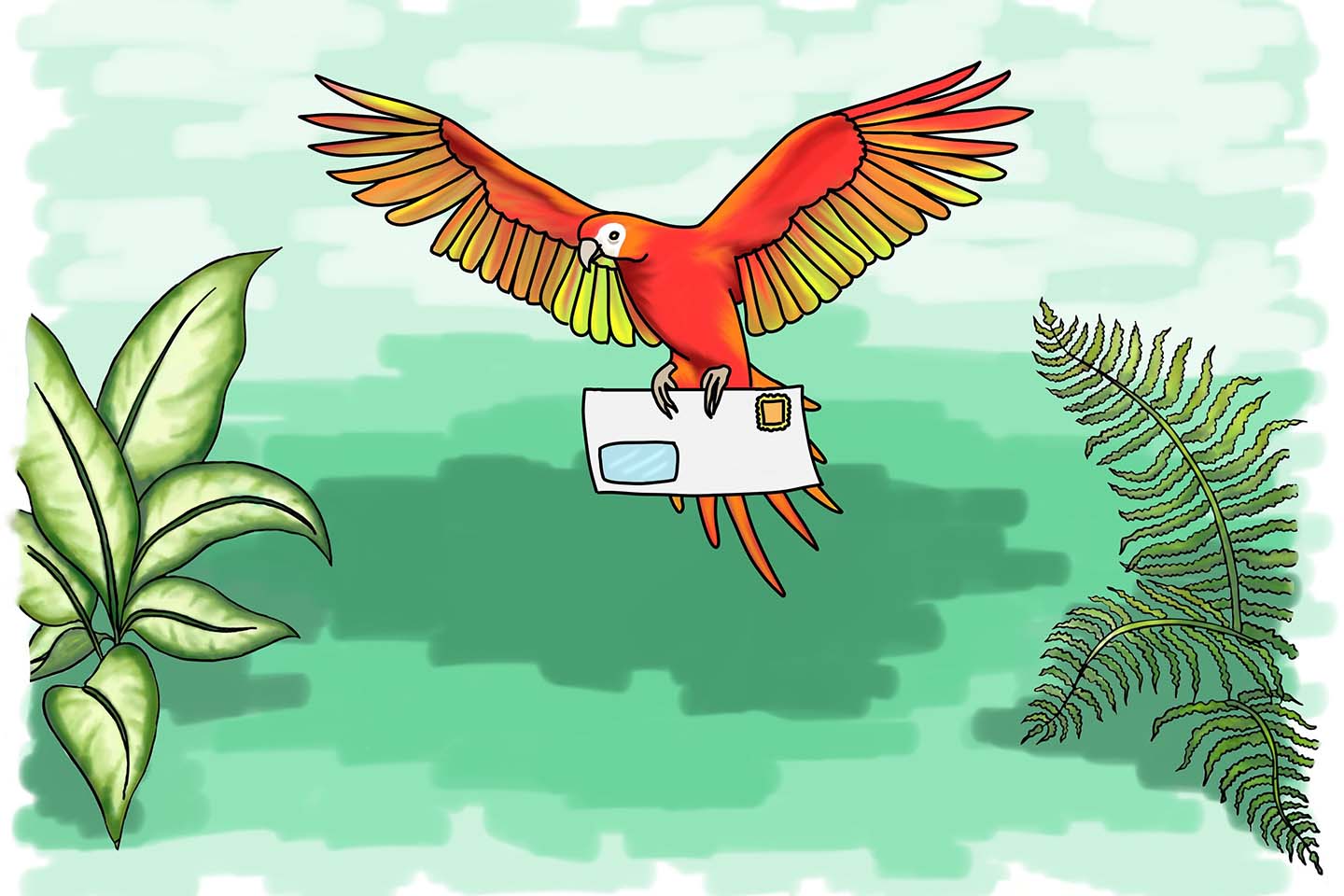Gut 20 Jahre ist es her, dass Eylem Emir aus der Türkei nach Deutschland kam. Aber sie erinnert sich noch daran, wie verwirrt sie am Anfang von dem Verhalten der Leute hier war: „Als ich die Deutschen so reden hörte, wie sie es normalerweise tun, kamen sie mir manchmal vor wie Roboter – ohne Gefühle“, erzählt sie. „Ich war erstaunt darüber, dass sie nonverbal längst nicht so stark kommunizieren, wie ich es gewohnt war. Gefühle schienen sie kaum zu zeigen – ich fragte mich schon, ob sie überhaupt welche haben …“
Wie Emir geht es vielen Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Sie verstehen vielleicht, was die Leute hier sagen – aber sie werden trotzdem nicht schlau aus ihnen. Ein Grund dafür liegt in der nonverbalen Kommunikation, also in dem, was wir mitteilen, ohne zu sprechen.
Die Deutschen sind schon ein sprödes Volk – zumindest auf den ersten Blick
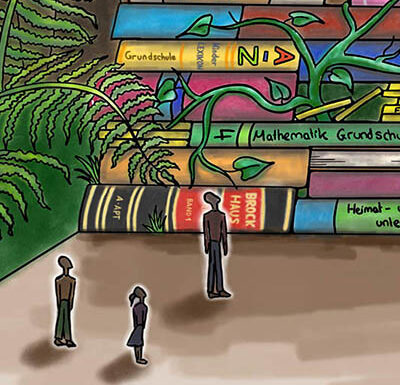
In dieser Serie berichten Lehrerin Heidemarie Brosche und Erzieherin Eylem Emir von ihren Erfahrungen an einer Brennpunktschule. Viele ihrer Schülerinnen und Schüler haben Wurzeln in anderen Kulturen, viele Familien sind finanziell und sozial benachteiligt, viele Eltern haben selbst nur eine geringe formale Bildung. Wie sieht der Alltag in den Familien aus? Wie wirkt er sich auf den Schulalltag aus? Und was können Lehrkräfte machen, um ihre Schülerinnen und Schüler zu fördern? Das analysieren Emir und Brosche in der zwölfteiligen Serie. Hier geht es zur Übersicht.
Was wir durch Mimik und Gestik aussagen, durch Körpersprache und die so genannte Proxemik, also durch die Distanz, die wir zu anderen halten (oder eben nicht): All das ist in hohem Maße kulturabhängig. Kulturen, bei denen der indirekte Kommunikationsstil vorherrscht, vermitteln üblicherweise besonders viele Botschaften nonverbal. In Ländern wie Deutschland hingegen, wo die Leute sehr direkt kommunizieren, sind körperliche Signale meist viel weniger ausgeprägt – und daher für neu Angekommene schwer zu verstehen und leicht zu übersehen.
Im Alltag führt das schnell zu Missverständnissen, auch in der Schule. Die anderen Eltern wirken unserer Familie gegenüber so kühl? Vielleicht mögen sie uns nicht! Die Lehrerin zeigt im Elterngespräch so gar kein Bedauern, dass unsere Tochter traurig über ihre schlechten Noten ist? Dann ist ihr unser Kind wohl egal! Wer sich in der neuen Umgebung abgelehnt fühlt, wird sich eher zurückziehen als integrieren.
Dabei wäre gerade Letzteres wichtig – denn nonverbale Kommunikation lässt sich ebenso erlernen wie verbale. Eylem Emir: „Inzwischen weiß ich längst, dass die Deutschen ihre Gefühle sehr gut und angemessen zeigen – nur eben anders, als ich es aus meiner Heimat kannte. Heute kommt mir selbst die Art, wie in meiner Kultur Gefühle gezeigt werden, zum Beispiel in Zusammenhang mit Trauer, vollkommen übertrieben vor. Bei uns ist es eben sehr wichtig, dass alle sehen, wie sehr man trauert.“
Nonverbale Kommunikation: das Problem mit dem Blickkontakt
Es sind jedoch längst nicht immer die Hinzugekommenen, die nonverbale Signale missverstehen – umgekehrt sind Probleme ebenso häufig. Zum Beispiel betreute eine Bekannte von Eylem Emir als Sozialarbeiterin eine afghanische Familie, die dringend einen Hortplatz für eines ihrer Kinder brauchte. Die Sozialarbeiterin begleitete den Vater zum Kindergarten, an dem es auch einen Hort gab. Die Leiterin stellte ihre Fragen, die Sozialarbeiterin wiederholte diese in einfacherem Deutsch, und der Vater gab Antworten. Plötzlich sagte die Leiterin: „Nein, das mit dem Hortplatz wird so nichts! Er soll gefälligst erst mal in mein Gesicht schauen, wenn er mit mir redet, bevor er einen Hortplatz will. So ein respektloses Verhalten, und dann soll ich ihm einen Platz für sein Kind zur Verfügung stellen!“
In diesem Fall konnte die Sozialarbeiterin erklären, dass genau das Gegenteil der Fall war: Der Vater zeigte der Leiterin seinen Respekt, indem er ihr nicht ständig ins Gesicht schaute, sondern auf den Boden, in die Luft, kurz mal in ihr Gesicht, dann wieder zu Boden … In seiner Kultur schaut man einer Autoritätsperson nicht in die Augen! Die Leiterin aber hatte es entgegengesetzt interpretiert: Sie fühlte sich als Frau in leitender Funktion von diesem Mann geringgeschätzt.
In Deutschland kann man jedem in die Augen schauen. Davor hatte ich früher Angst
Eylem Emir kennt das Problem aus ihrer eigenen Erfahrung als Zugezogene: „Ich selbst habe das mit dem Blickkontakt regelrecht geübt. Vor ca. acht Jahren, als ich noch in meiner ‚Übungsphase‘ war, saß ich als Elternsprecherin mal dem Chef der Schule gegenüber. Wir hatten ein Gespräch zu führen. Ich bemühte mich mit aller Kraft, ihm ins Gesicht zu schauen und den Blick nicht ständig abzuwenden. Es gelang mir und ich war schon fast ein bisschen stolz auf mich. Am Ende aber merkte ich, dass ich überhaupt nicht mitbekommen hatte, was er mit mir geredet hatte. So sehr habe ich mich auf das mit dem Blick konzentriert, so anstrengend war das für mich, dass der Inhalt an mir vorübergegangen ist.“
Emir erläutert: „Hier in Deutschland ist die Machtdistanz ja so gering, dass man jeder und jedem in die Augen schauen kann. Und der Blickkontakt stellt einen Wert dar, der auch an die Kinder weitervermittelt wird. Inzwischen beherrsche ich den Blickkontakt auch. Aber mir steckte eben lange in den Knochen, dass man bei uns früher den Blick mit Angst verbunden hat: Direkt in die Augen wurde nur geschaut, wenn etwas nicht in Ordnung war. Man dachte dann sofort: Was habe ich falsch gemacht? Ich kann heute nach 22 Jahren problemlos in die Augen schauen – egal ob einem Mann oder einer Frau –, ohne die Konzentration zu verlieren. Ich kann auch den direkten Blick aushalten, ohne wieder Angst zu spüren. Aber ich habe es eben auch bewusst geübt.“
Nonverbale Kommunikation ist auch ein Machtinstrument

Vor allem bei Jugendlichen kann Blickkontakt auch ein Machtspiel sein: Wer als Erster den Blick abwendet, hat verloren, hat akzeptiert, dass das Gegenüber das Sagen hat. Wenn Menschen mit großem Aggressionspotential aufeinandertreffen, kann ein Blick auch schon der Anlass für eine Prügelei sein: „Was starrst du mich an?“ Dahinter steht der Gedanke: „Wie kannst du es wagen, mir einfach so direkt in die Augen zu schauen?“
Kommunikation ist auch ein Machtinstrument, in allen Kulturen. Das gilt insbesondere auch für nonverbale Kommunikation. Herrscht zudem – wie in vielen Familien, die aus dem arabischen oder afrikanischen Raum nach Europa kommen – ein autoritärer Erziehungsstil mit großer Machtdistanz, wird das besonders deutlich. Das Sagen hat in diesen Familien, wer in der Hierarchie oben steht. Meist ist dies der Vater, dann die Mutter, manchmal auch an zweiter Stelle schon der älteste Sohn. Eine autoritäre Kommunikation dient dabei schon allein dem Erhalt der kollektivistischen Grundlage der Gemeinschaft. Doch je autoritärer es in den Familien zugeht, umso mehr kommt es zu Störungen in der Kommunikation.

Die Kinder haben so von Anfang an keine guten Sprachvorbilder im Sinne gelingender, konstruktiver Kommunikation, wie sie in Schulen erwartet wird. Sie kennen keine demokratischen Gesprächsregeln, oft führen die Erwachsenen überhaupt kaum Gespräche mit ihnen, oder es herrscht eine ambivalente Kommunikation. Die Kinder gewöhnen sich bei einer derartigen Kommunikationskultur daran, dass Menschen sich ständig gegenseitig unterbrechen, und sie tun dies irgendwann selbst auch. Sie bekommen oft zu hören: „Du hast es falsch gemacht!“, im Sinne von: „Du bist schlecht!“
Manche Kinder reagieren nur noch auf strenge Worte
Die Kinder gewöhnen sich angesichts dessen, wie sie erzogen werden und dass mit ihnen sehr wenig gesprochen wird, noch an etwas anderes: dass Menschen sehr laut und streng mit ihnen reden, wenn es um etwas Wichtiges geht. Das wird dann zum Problem, wenn die in der Schule auf Lehrkräfte treffen, die ruhig, respektvoll und wertschätzend mit den Kindern umgehen.
Erzieherin Eylem Emir erzählt: „Als ich einmal ein Praktikum in einer Grundschule machte, konnte ich in wirklich allen Klassen Folgendes beobachten: Die Kinder saßen ganz lieb und willig auf ihren Plätzen, die Lehrkraft richtete ruhig das Wort an sie. Sie sagte zum Beispiel: ‚Jetzt holst du dein rotes Heft aus der Schultasche. Dann nimmst du den gelben Stift aus deinem Mäppchen …‘ Aber bei den Kindern kam wenig an, sie haben sich kaum angesprochen gefühlt und entsprechend oft auch nicht reagiert. Man hatte es ihnen zu Hause einfach nicht beigebracht, auf so ruhige Worte zu reagieren. Erst wenn die Lehrkraft laut wurde und ins Schimpfen kam, reagierten die Kinder.“

Emir ging dann zu einzelnen Kindern und fragte sie leise: „Schau, der Lehrer hat etwas zu dir gesagt, hast du das gemerkt?“ Die Antwort, die sie immer wieder bekam: „Nein!?“ Emir: „Für die Lehrkräfte fühlt sich das an, als seien die Kinder respektlos und nicht gut erzogen, wenn sie einfach nicht reagieren. Dabei haben sie die Wichtigkeit der Aufgabe einfach nicht mitbekommen, denn es war niemand laut und streng zu ihnen. Zum Glück habe ich gesehen, dass viele Lehrkräfte diese Herausforderung toll meistern, sie bleiben beim ruhigen Tonfall, schimpfen nur in seltenen Fällen, beharren auf den Gesprächsregeln, und man spürt dann im Laufe eines Schuljahres, wie sich die meisten Kinder daran gewöhnen und irgendwann eben auch auf ruhige Worte reagieren.“
Impulse von Lehrkraft zu Lehrkraft
Geduld ist wichtig, damit Kinder ihre Kommunikationsgewohnheiten umstellen können – auch wenn sie schwer fällt. Einige von uns Lehrkräften gehen zum Beispiel gern auf Augenhöhe mit den Kindern, machen Witze und zeigen ihnen ihre Wertschätzung. Autoritär erzogene Kinder können damit aber oft nicht umgehen, weil sie diese mangelnde Machtdistanz im Umgang mit ihnen nicht kennen. Solche Kinder schließen aus dem Lehrerverhalten: Mit dieser Lehrkraft kann ich reden, wie ich will. Die Lehrkraft wiederum empfindet dies verständlicherweise als respektlos, möglicherweise zieht sie daraus sogar Schluss: „Dann mache ich das eben nicht mehr. Dann bin ich eben nicht mehr nett.“
Wenn wir jedoch selbst ins Autoritäre verfallen, haben wir damit zwar vielleicht kurzfristig Erfolg. Wir vergeben aber die Chance, dass die Kinder von uns eine bessere Form der Kommunikation lernen. Deshalb sollten wir:
- uns die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation bewusst machen, um besser einordnen zu können, wenn unsere Schülerinnen und Schüler sich ungewohnt verhalten;
- uns bewusst machen, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler zu Hause keinerlei demokratische Gesprächsregeln kennen lernen, und sich deshalb scheinbar respektlos uns gegenüber verhalten;
- unsere eigene Haltung sehr klar vertreten, nicht an unseren demokratischen Kommunikationsregeln rütteln lassen und immer wieder beharrlich darauf eingehen, damit die Kinder Fortschritte machen können;
- Ich-Botschaften senden, sachbezogen kommunizieren und obendrein noch unsere Vorbildfunktion nutzen:
Nicht: „Du bist frech und ungezogen!“ Sondern: „Ich kann dir nichts erklären, wenn du mir nicht zuhörst. Das ist auch für mich schwierig.“
Nicht: „Du hast es falsch gemacht.“ Sondern: „Das Ergebnis ist falsch.“
Über die Autorinnen

Die Pädagogin und Autorin Heidemarie Brosche hat seit 1977 an Grund- und Hauptschulen unterrichtet sowie zahlreiche Sach- und Kinder- und Jugendbücher verfasst. Für ihr Engagement für Leseförderung und Bildungsgerechtigkeit wurde sie 2020 mit dem „Volkacher Taler“ der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur geehrt. www.h-brosche.de
Nonverbale Kommunikation: „Deutsche reden wie Roboter“ – Dieser Artikel ist Teil der Serie „Bildungsfern? Bildungs-anders! Eine Übersicht aller weiteren Artikel finden Sie hier. Illustration: Ariane Dick Bellosillo/Magazin SCHULE